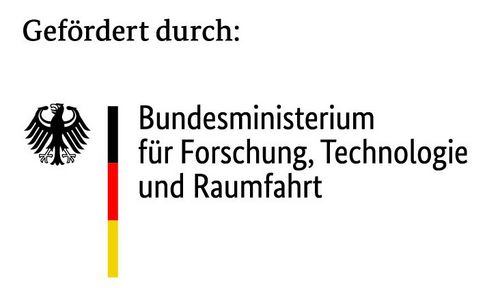EQuiP: Für vernetztes Psychosoziales Krisenmanagement
Von der Polykrise zur Resilienz: Entwicklung Netzwerkorientierter Qualität im Psychosozialen Krisenmanagement staatlicher Verwaltung

- Projekt
EQuiP – Entwicklung Netzwerkorientierter Qualität im Psychosozialen Krisenmanagement staatlicher Verwaltung
- Laufzeit
01. Oktober 2024 bis 30. September 2027
- HWR Berlin
Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit (FÖPS)
- Projektverantwortlich
Prof. Dr. Vincenz Leuschner
- Projektbeteiligte der HWR Berlin
Dr. Mika Josephine Moeller
Verena Flörchinger
Malena García Lombardi - Projektpartner
Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH)
Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin (SenInnSport)
Gesundheitsamt Frankfurt am Main - Assoziierte Partner
Notfallseelsorge/Krisenintervention Berlin
Notfallseelsorge Frankfurt, Diakonisches Werk
Kriseninterventionsteam ASB München
Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) Mecklenburg-Vorpommern
Der Beauftragte für Polizei- und Notfallseelsorge der Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW)
Landesfeuerwehrschule Schleswig-Holstein, Landeszentralstelle PSNV
Erzbischöfliches Ordinariat München, Notfallseelsorge
Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie
Feuerwehrseelsorge Hamburg / Leitung Notfallseelsorge
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK)
Medical School Hamburg GmbH - Gefördert durch
Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)
- Projektwebseite
Worum geht es im Kern?
Krisen sind gemachte Realitäten: Ob starke Stressoren zu einer Krise oder Katastrophe eskalieren, ist abhängig von der Resilienz einer Community – der Fähigkeit von Staat und Gemeinschaften, Schocks aufzunehmen, sich anzupassen und gewandelt fortzubestehen. Solche Stressoren können durch Pandemien, Terroranschläge, großflächige Schadensereignisse oder klimabedingte Extremereignisse wie Starkregen und Dürren ausgelöst werden – ebenso wie durch die komplexen Koordinations- und Unterstützungsaufgaben, die entstehen, wenn viele Menschen zur Flucht und zu Migration gezwungen sind. Diese Stressoren beeinträchtigen nicht nur Infrastrukturen, sondern auch das psychosoziale Wohlbefinden der Bevölkerung. Das Verbundprojekt EQuiP zielt darauf ab, die Qualität und Struktur eines netzwerkorientierten psychosozialen Krisenmanagements staatlicher Verwaltung weiterzuentwickeln und damit die community resilience dauerhaft zu stärken. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie staatliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen wirkungsvoll und nachhaltig zusammenarbeiten können.
Was motiviert Sie für dieses Thema?
Polykrisen – sich überlagernde, wechselseitig verstärkende Krisen – fordern Staat und Gesellschaft heraus und überfordern bestehende Notfallstrukturen. Im bisherigen umfassenden Krisenmanagement werden psychosoziale Aspekte jedoch häufig unterschätzt und unzureichend berücksichtigt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, sind robuste, vernetzte Strukturen nötig, die weit über die akute Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) hinausreichen und community resilience fördern. Genau hier setzt unsere Forschung an.
Wie war die Ausgangslage?
PSNV ist derzeit fast ausschließlich auf die Akutphase ausgerichtet und endet meist nach spätestens sieben Tagen. Für die mittel- und langfristige Begleitung, ebenso wie für die Vorbereitung auf Schadensereignisse fehlen verbindliche Qualitätsstandards und abgestimmte Strukturen, die staatliche Behörden, professionelle Dienste und zivilgesellschaftliche Initiativen effektiv und zuverlässig vernetzen. Die fragmentierte Akteurslandschaft braucht deshalb verlässliche Konzepte und Rahmenbedingungen für Kooperation und Qualitätssicherung.
Welche konkreten Ziele verfolgt das Projekt?
- Entwicklung eines praxisnahen Handlungskonzepts. Erarbeitung von Qualitätsstandards für das Psychosoziale Krisenmanagement
- Förderung und Stärkung der community resilience durch Verbesserung der Vernetzung & Zusammenarbeit zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteur*innen
- Entwicklung eines modularen Blended-Learning-Fortbildungskonzepts
- Strukturelle Verankerung eines umfassenden und nachhaltigen Psychosozialen Krisenmanagements über akute Phasen hinaus
Wie wollen Sie diese Ziele erreichen?
Das Projekt EQuiP ist als Verbundvorhaben organisiert, in dem die HWR Berlin sowohl koordinierende als auch forschende Aufgaben übernimmt. Gemeinsam mit den Kolleg*innen der Alice Salomon Hochschule Berlin sowie den Praxispartner*innen aus dem Gesundheitsamt Frankfurt am Main und der Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin entwickeln wir Lösungen für ein nachhaltiges psychosoziales Krisenmanagement. Die Zusammenarbeit mit weiteren assoziierten Partner*innen – etwa aus Notfallseelsorge, Feuerwehr und Bevölkerungsschutz – sorgt für einen engen Praxisbezug.
Ein interdisziplinäres Forschungsteam der HWR – mit Expertise in Psychologie, Anthropologie, Geographie, Sicherheitsforschung und Katastrophensoziologie – untersucht dazu vier bewusst kontrastierte Krisenfälle in Deutschland (rassistisch-motivierter Anschlag in Hanau 2020, Ankunft Geflüchteter aus der Ukraine in Berlin, Flutkatastrophe 2021, Dürre und Wasserknappheit in Thüringen) . Die Auswahl orientiert sich vor allem an Unterschieden im Gefahrentyp, der Geschwindigkeit des Ereigniseintritts (rapid- vs. slow-onset), der Dauer der Belastung sowie am urban beziehungsweise ländlich geprägten Kontext. Mit der Methode der Situationsanalyse leitet das Team aus den vier kontrastierten Fällen praxisnahe Qualitätsstandards sowie ein Handlungskonzept zur Vernetzung staatlicher und zivilgesellschaftlicher Akteur*innen ab; anschließend werden die Ergebnisse in ein modulares Blended-Learning-Programm überführt und gemeinsam mit den Praxispartnern pilotiert, um die angestrebte Stärkung der community resilience und der Handlungsfähigkeit von Verwaltung und Einsatzdiensten nachhaltig zu verankern.
Was haben Sie schon herausgefunden?
Unterschiedliche Zeitlichkeit und Handlungslogiken
Der international definierte Krisenmanagement-Zyklus (Preparedness → Response → Recovery), der psychosoziale Krisenmanagement-Zyklus und community-resilience-Prozesse haben jeweils ihre eigene Zeitlichkeit. Diese Zeitversätze bringen eigene Handlungslogiken hervor, wodurch an den Phasenübergängen Reibungen entstehen – Akteur*innen aus Verwaltung, Einsatzdiensten und Zivilgesellschaft können die Perspektiven der jeweils anderen häufig nur schwer nachvollziehen.
- Sekundäre psychosoziale Krisen
Unzureichend koordinierte oder zu kurzfristig angelegte Krisen-Response-Maßnahmen, die psychosoziale Aspekte außer Acht lassen, können selbst als Stressoren wirken: Sie lösen zusätzliche psychosoziale Krisen aus und erhöhen die Gesamtbelastung. - Community resilience als Strategie
Community resilience erweist sich als strategischer Ansatz im psychosozialen Krisenmanagement: Werden psychosoziale Kompetenzen, Netzwerkarbeit und adaptive Kapazitäten phasenübergreifend verankert, entsteht eine gemeinsame Sprache und ein geteiltes Verständnis zwischen Einsatzkräften und Bevölkerung.
Was hat Sie überrascht?
Die Vielfalt und Professionalität zivilgesellschaftlicher Akteur*innen im Bereich der psychosozialen Versorgung ist beeindruckend – ebenso wie ihr Bedarf an struktureller Einbindung. Viele arbeiten seit Jahren engagiert, aber ohne stabile Anbindung an staatliche Prozesse. Hier gibt es enormes Potenzial, das bislang ungenutzt bleibt.
Welchen Beitrag leistet das Projekt zum Thema Nachhaltigkeit?
EQuiP trägt zur sozialen Nachhaltigkeit bei, indem es Strukturen schafft, die Menschen auch langfristig auffangen. Resiliente Gemeinschaften entstehen nicht allein durch Technik oder Infrastruktur – sie brauchen verlässliche soziale Netzwerke und langfristige Versorgungsperspektiven
Kontakt:
Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement
Prof. Dr. Vincenz Leuschner, Professor für Kriminologie und Soziologie
Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit (FÖPS)
vincenz.leuschner (at) hwr-berlin.de